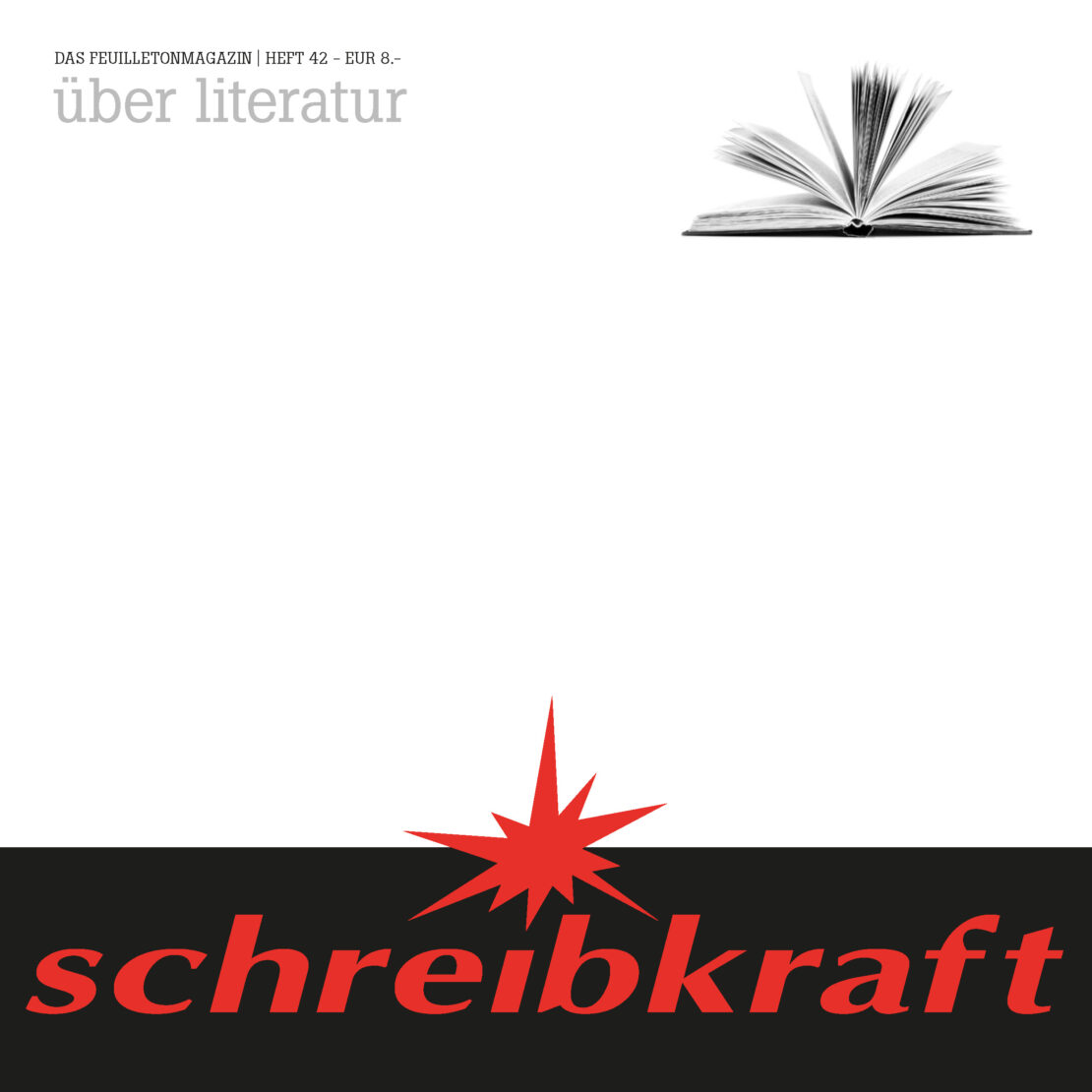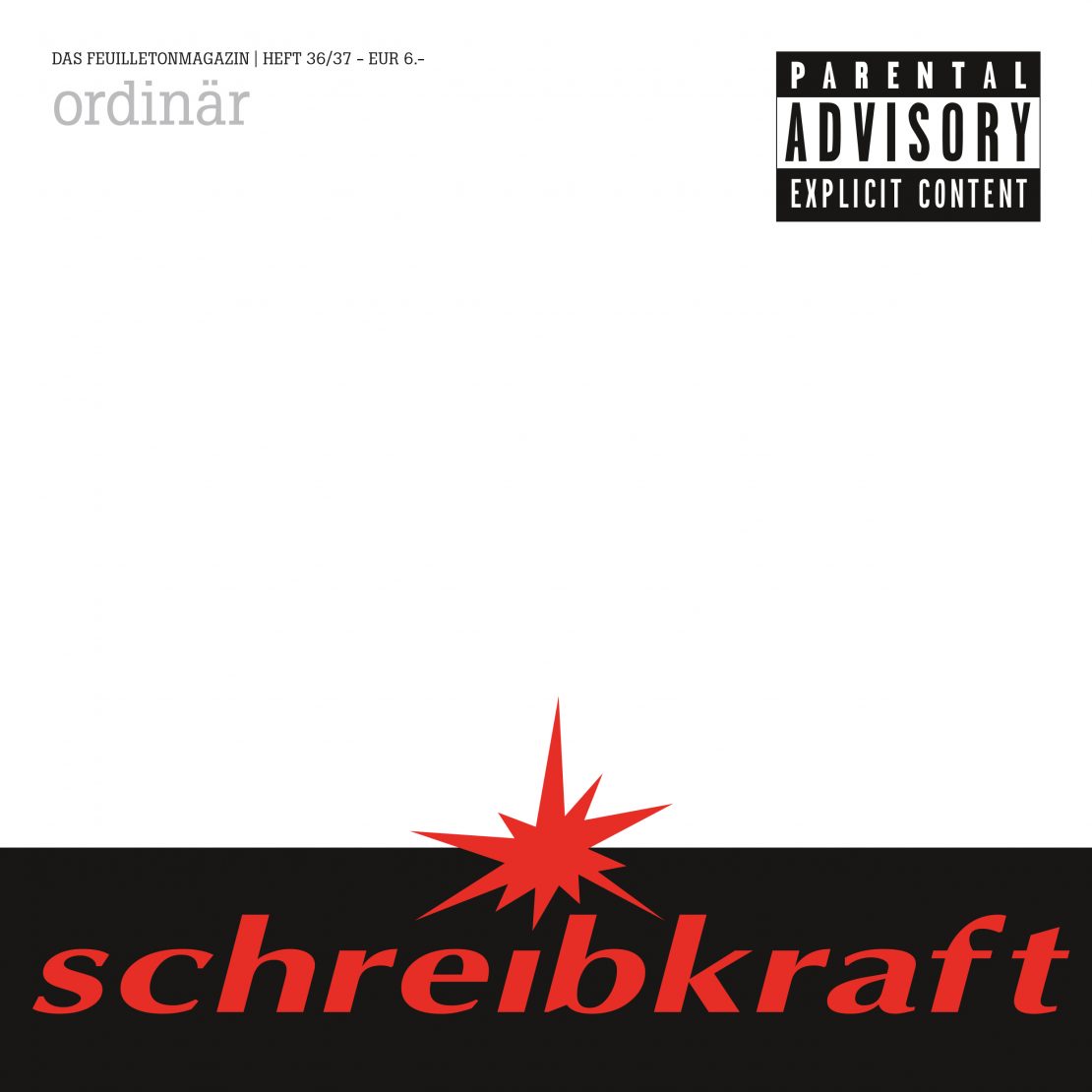Robert Zimmermann kann nicht gut singen. Mundharmonika und Gitarre spielt er auch nicht soooo toll. Aus diesem Grund hat er auch den Literaturnobelpreis bekommen. Und nicht den Polar-Music- oder den Kyoto-Preis (oder gar die Romy). Die Frage ist nur: Wären seine Texte auch ohne ihre musikalische Form und Vermittlung nobelpreiswürdig? Eine Frage, die Literaturkritik und Fangemeinde wahrscheinlich auf Jahrzehnte hinaus zu gleichen Teilen beschäftigen wird – und die wir im vorliegenden Heft auch keinesfalls beantworten.
Denn schließlich ist die schreibkraft weder Literatur- (wie wir schon in der Vorrede des letzten Hefts ausgeführt haben) noch Musikzeitschrift! Was uns aber natürlich nicht daran hindert, uns mit diesen beiden Kunstformen und deren Schnittmengen immer wieder zu beschäftigen.
Hier und jetzt also: mit Musik. Mit lauter und leiser, geliebter und gehasster Musik, mit veränderten Verhältnissen und mit der Frage, warum ein- und derselbe Sound Leben bedeuten kann oder eben nur Lifestyle. Wie konnte Musikgeschmack für Generationen Identität und soziale Heimat bedeuten, wenn er sich heute von einem simplen Algorithmus weit besser identifizieren lässt? Wie kommts zum Megatrend ehemalige-Popstars-schreiben-plötzlich-Bücher?
Einerseits sicherlich aus Vermarktungsgründen, bringen Popstars doch im Idealfall homogene Fangruppen und vielbespielte Social-Media-Kanäle mit. Was sie dann schreiben ist oft sekundär. Bei anderen wieder ist schon seit jeher die literarische Qualität in ihren Texten eingeschrieben (siehe oben). Der wichtigsten Vertreter der zweiten Spezies ist zweifellos Hans Platzgumer, der dieses Heft eröffnet, dabei problemlos Guy Debord und David Guetta zusammendenkt und unmissverständlich klarstellt: „Die größte Herausforderung ist es wohl, im Laufe eines Menschenlebens nicht zum Nostalgiker zu verkommen. Jeden Morgen mache ich mir aufs Neue bewusst, dass früher die Dinge nicht besser waren. Bis zum Abend ist diese zarte Einsicht wieder aufgebraucht. Ich muss sie mir am nächsten Morgen erneut in Erinnerung rufen.“ An dieser Challenge beteiligen wir uns sehr gerne – auch weit über musikalische Aspekte hinaus!
Weiter geht’s mit Klassikern. Noch einmal Bob Dylan: Doris Neidl war auf einem seiner Konzerte („Ich glaube mich zu erinnern, dass er in einer Tour vom Sessel heruntergefallen ist.“) gesteht aber vor allem, dass sie Kulturveranstaltungen am allerliebsten allein besucht. Hans Koppelredder räumt im Interview ein, dass er als der Beatles-Blockwart wohl so manche Karriere von hoffnungsvollen Coverbands frühzeitig zerstört hat, und Doris Claudia Mandel berichtet von den Jahren ihrer Zusammenarbeit mit Mikis Theodorakis. Wolfgang Pollanz wiederum arbeitet sich an einer, in popkulturellen Zusammenhängen so häufig aufkommenden, Verschwörungstheorie ab: Nein, Paul McCartney ist nicht als 28jähriger verstorben. Abgerundet wird das Heft mit literarischen Texten von Daniel Wisser, Sibylle Severus und Peter Campa sowie ausgewählten Songtexten, die Sie auf ihre literarische Qualität hin überprüfen können.