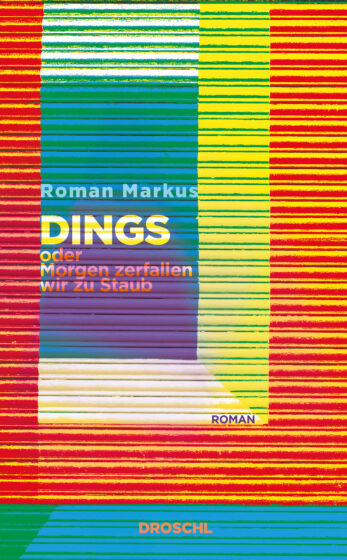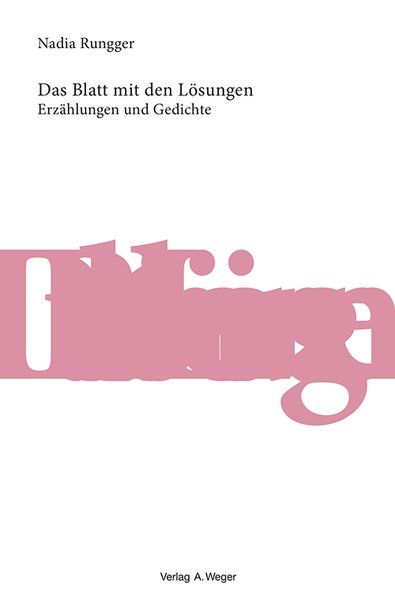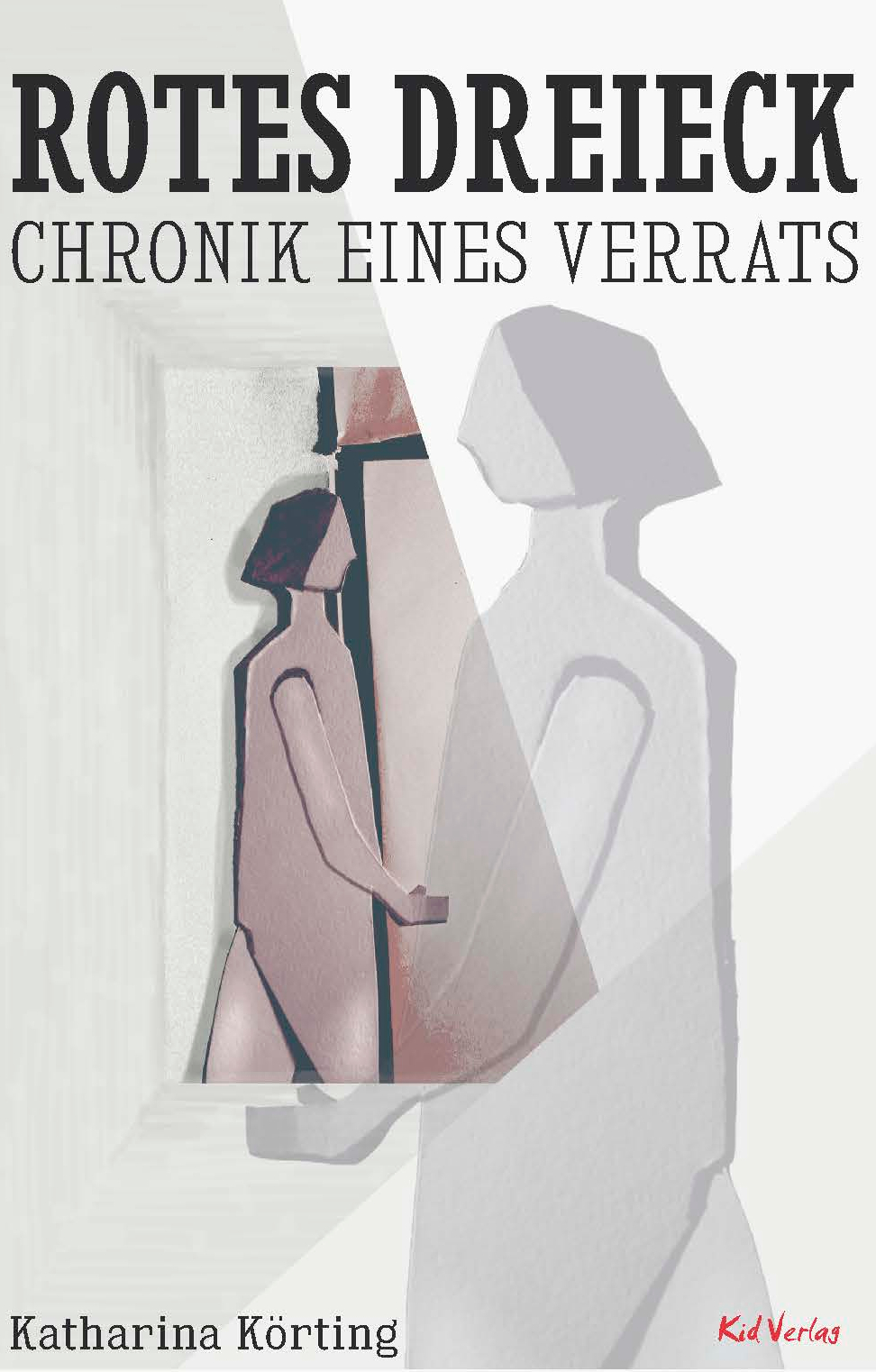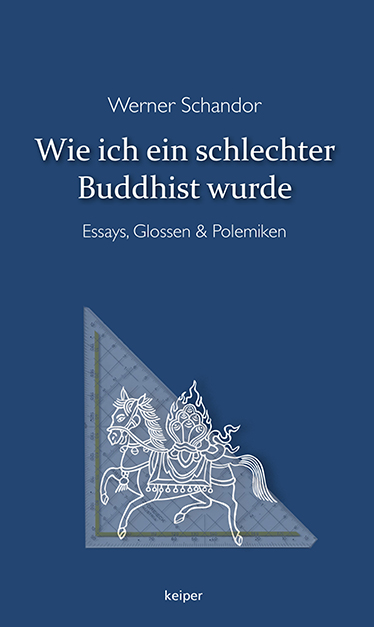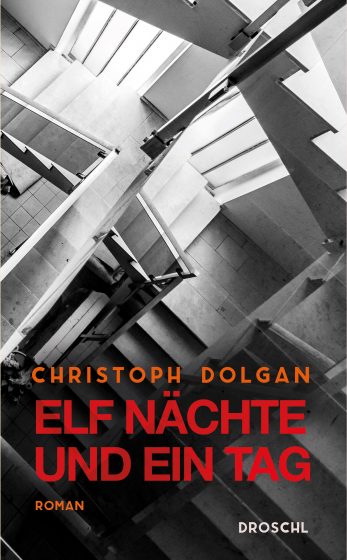Wie war das noch mal?
Roman Markus hat mit „Dings“ einen wunderschönen Roman aus den 1990ern geschrieben.
Natürlich ist es Zufall, dass der Autor Roman heißt. Und sein Roman (wie die Hauptfigur) Dings. Aber das leise Spiel mit Wahrnehmungen, die zarten Fadenrisse in der sonst so geradlinig vorgetragenen Erzählung, die Roman Markus‘ Buch nicht zuletzt für den Literaturverlag Droschl empfohlen haben dürften, ließe auch hier Absicht vermuten.
Auf den ersten Blick ist Dings oder morgen zerfallen wir zu Staub die durch und durch unterhaltsame Schilderung eines Sommers, in dem das Leben des Protagonisten einen Knick erfährt, der unseren Dings aber nur vorübergehend aus der Bahn wirft. Was wohl daran liegt, dass es eine solche im engeren Sinne nie gab. Dings ist eben ein passiver Roman-Protagonist, wie er im Buche steht. Will heißen: in zahlreichen Büchern. Ziel- und mindestens ebenso antriebslos lässt sich der junge Mann von mehr und weniger echten Freunden durch die Handlung treiben, die alkoholbedingt von einer Schnapsidee zur nächsten Niederlage torkelt. Job weg, Freundin weg, so nimmt die Geschichte zu Beginn Fahrt auf. Dann wird Wie-heißt-er-Nochmal buchstäblich von der Liebe überfahren – oder von etwas, das ihr auf verdammt schöne Weise ähnlich sieht – und von seinem hyperaktiven Kumpel auf einen Berlin-Trip (Eigenschaftswort bitte dazudenken, die Auswahl ist naheliegend) entführt. Das artet dann alles schon beinahe in Handlung aus. Bzw. in Stress für unseren Protagonisten. Zumal sich doch noch eine – temporäre – Institutionalisierung für seine Interpretation des Daseins als Blaupause und Ausfluchtversuch ergibt: die Bespielung eines modrigen Abbruchhaus-Kinos, das seinem bereits fixierten Ende entgegendämmert. (Am Ende zerfällt es dann zu Staub.)
Dings ist einer dieser sympathischen Loser, die ein bisschen schreiben, aber sich nichts darauf einbilden, einer, der manchmal philosophiert, aber dabei von seinem Erzähler nur in wenigen lichten (oder besser: dunkelschönen) Momenten ernst genommen wird. Er würde wahrscheinlich alles für die Liebe tun, ohne dabei an sie zu glauben, er möchte ziel- oder wahllos die Welt bereisen und findet sich doch wieder im Beisel beim fünften Bier. In alldem könnte er – so ein literarisch vielfach gestütztes Vorurteil – seinem Autor nicht unähnlich sein. Und genau hier setzt Roman Markus den eingangs angedeuteten Hebel an, der seinen Roman von einem lässigen Sommerbuch zu einem besonders lässigen, ja besonderen Buch macht. Den ersten vermeintlich dicken Strich durch die Rechnung mit der autobiografischen Handlung macht er, indem er diese irgendwo in den 1990ern ansiedelt. Und das ist (Achtung: Zufälle gibt’s nicht in der schönen Literatur) die Zeit, als unser Autor gerade in diese Welt geworfen wurde. In die 1990er passt dieser Held auch viel besser als ins Hier und Jetzt. Damals – wir, die wir Herrn Markus hier väterlich auf die Schulter klopfen können, erinnern uns – war alles weit weniger zeiteffizient, ziel- und verwertungsorientiert angemalt. Und es gab Teletext und Wählscheiben-Telefone, Autos ohne Klimaanlage, Kellerlokale mit halsbrecherischen Eingangstreppen und an den Universitäten pseudopolitisierte Dauerstudenten mit bestem bürgerlichen Hintergrund … Das alles flicht Markus unangestrengt in seine Erzählung ein. Und auch in seine Sprache verirren sich damalige Modewörter, ohne dass diese dabei zu einem bemühten Jargon verkommt. Zugleich reflektiert Roman Markus das Erzählen an sich. Nicht beständig, eher beiläufig in ausgesuchten Augenblicken. Er macht das augenzwinkernd, ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht mit bierschwerer Zunge, aber virtuos. Dann fragt er sich auch, wem diese Geschichte gehört. Ihrem Erzähler? Ihren Heldinnen und Helden? Ihren Leserinnen und Lesern? Es zahlt sich jedenfalls aus, sie sich zu eigen zu machen.