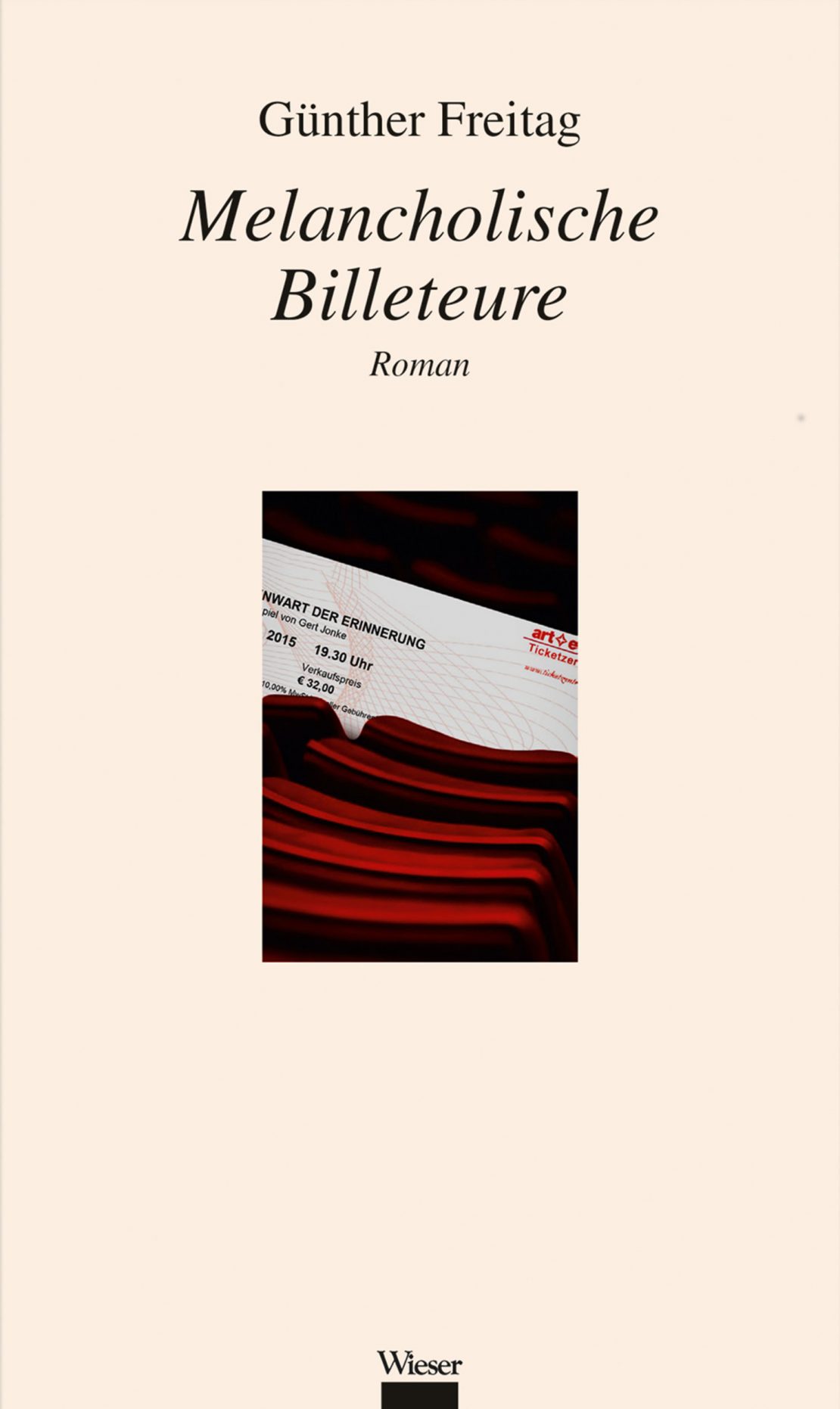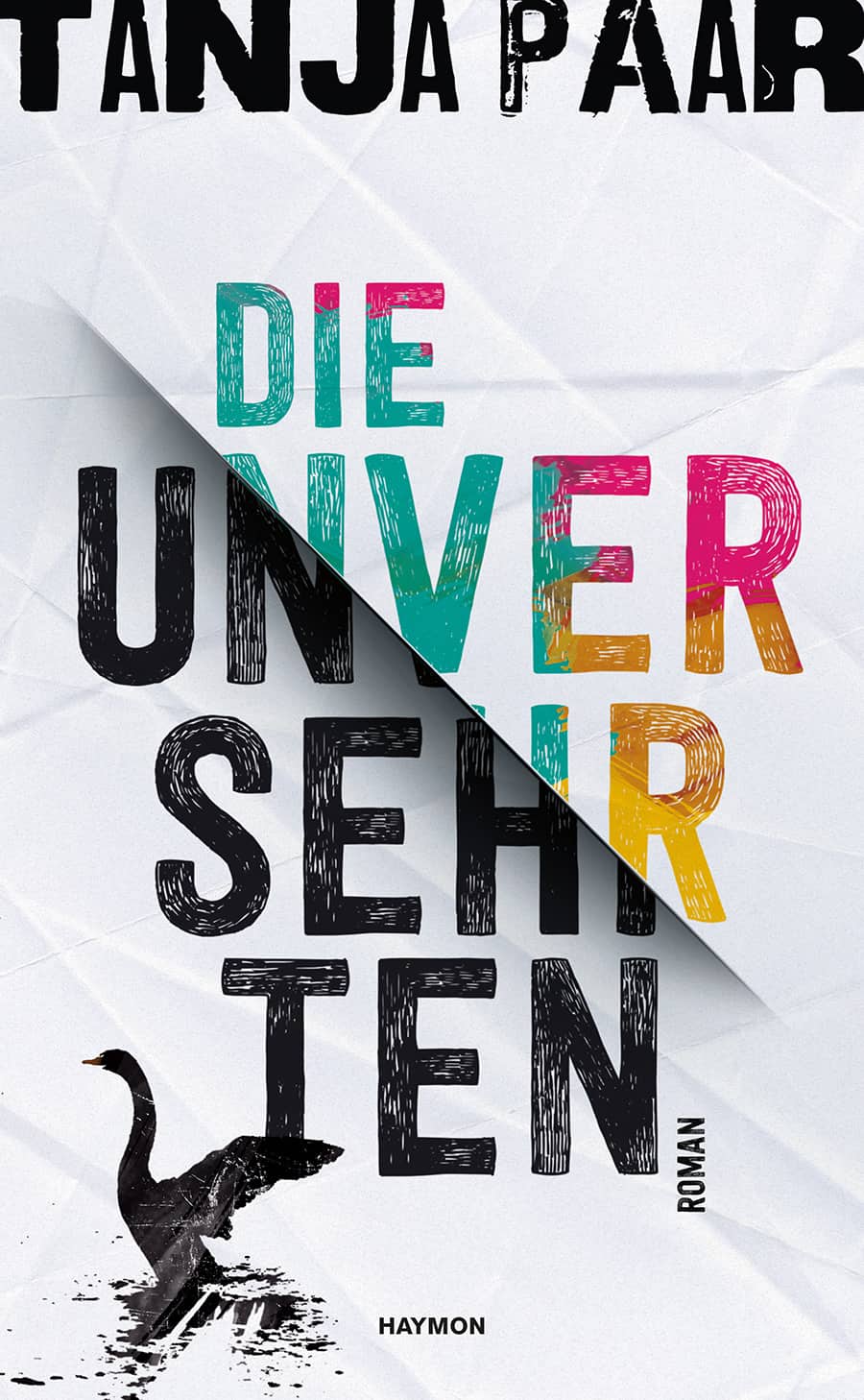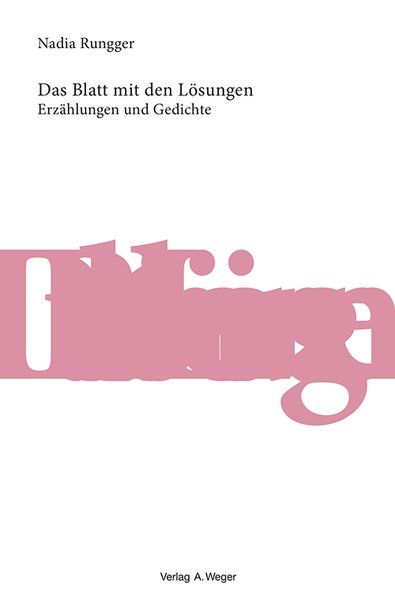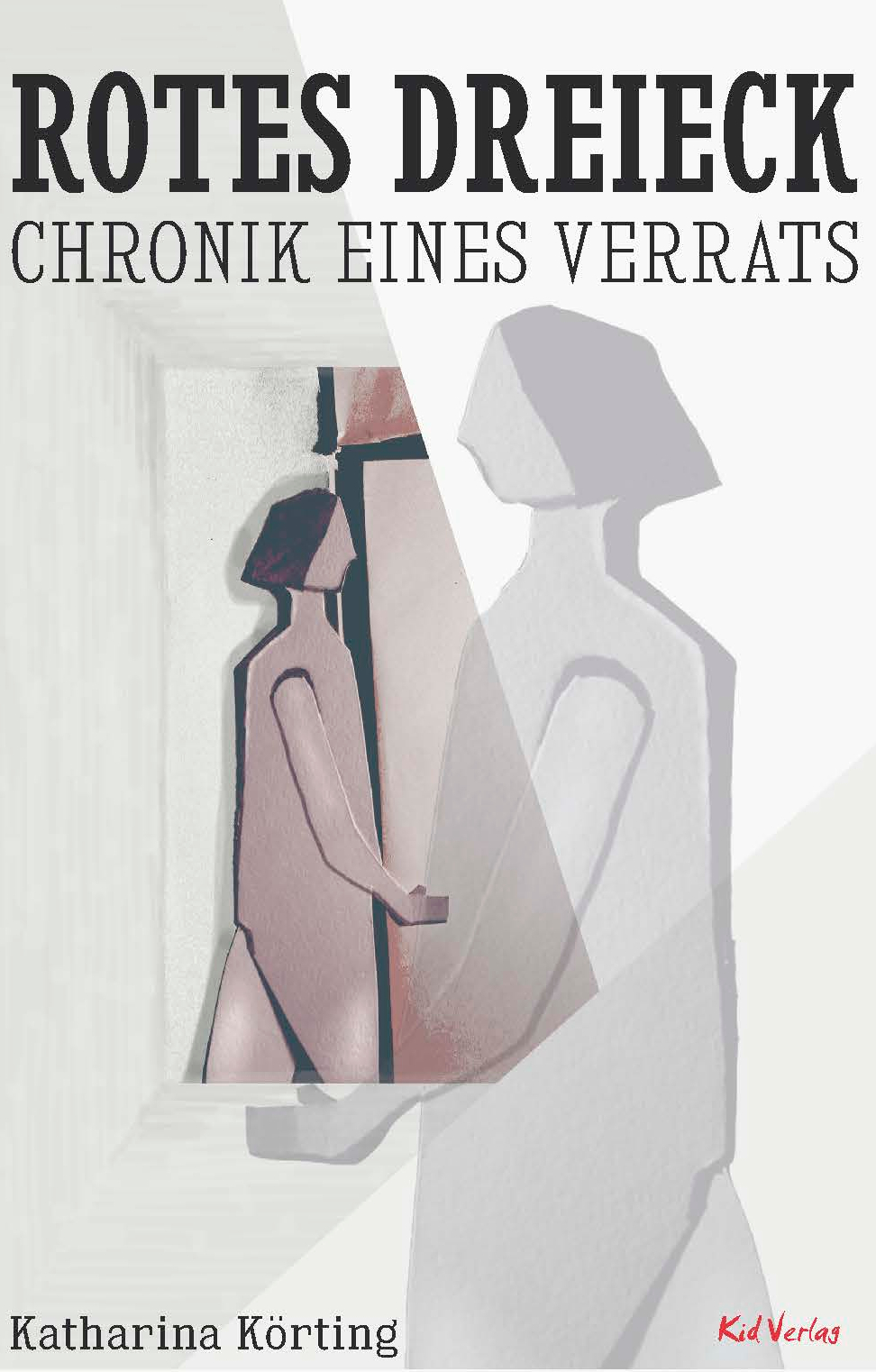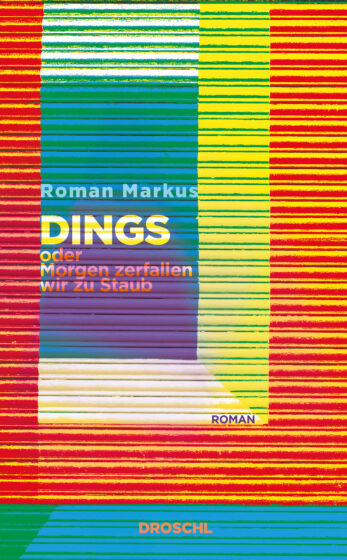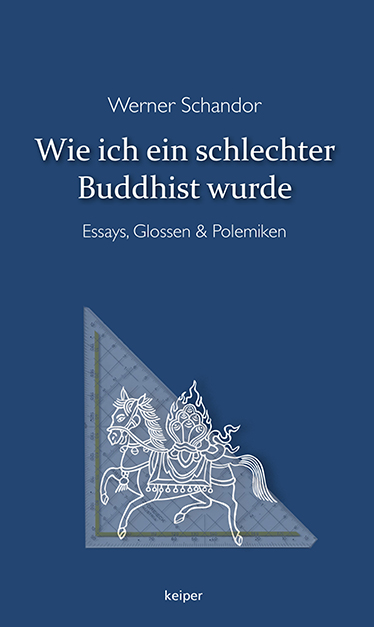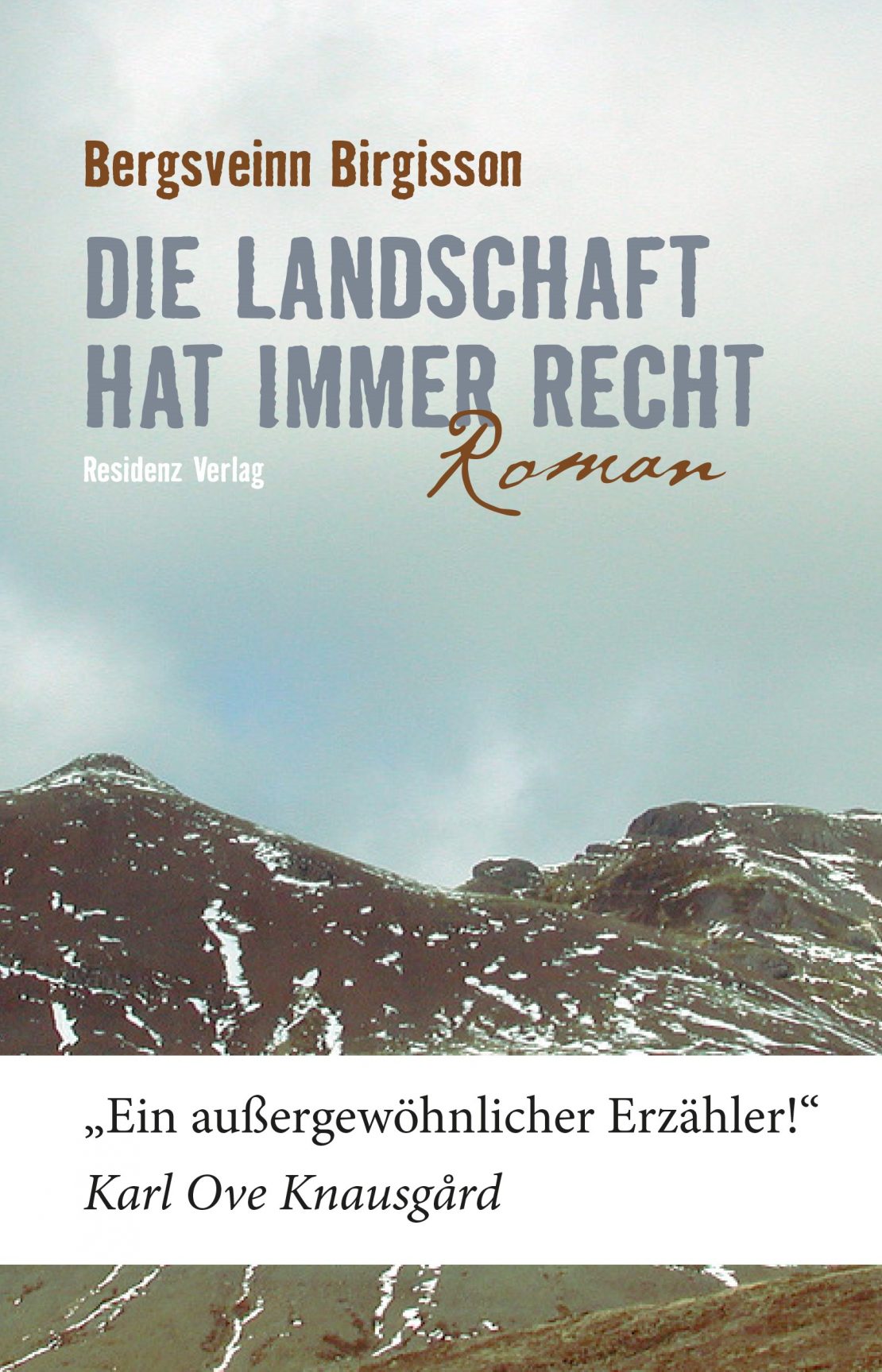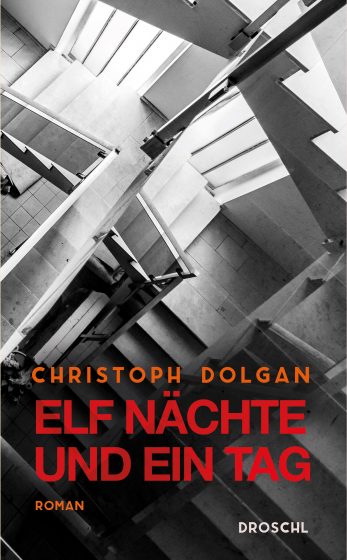Bretter, die die Welt bedeuten
Günther Freitags „Melancholische Billeteure“ täuschen sich prächtig.
Das Scheitern ist in unserem Kulturkreis nicht besonders gut angeschrieben. Scheitern, das meint Versagen, bedeutet Unfähigkeit, evoziert Probleme und Krisen und legt nahe, dass Fahrlässigkeit im Spiel war – wenn es freundlich zugeht. Geht es unfreundlich zu, kann schon mal das Stichwort Dummheit fallen. Was aber wären wir ohne das Scheitern und das auf ihn folgende Beharren? Wir hätten keine Glühlampen, keinen Harry Potter, wir hätten keinen Kommissar Brenner und Pablo Picasso wäre u.U. Gebrauchsgrafiker geworden.
In Günther Freitags Gesamtwerk ist das Scheitern ein stetig anzutreffendes Thema. Gleich wie die Musik eine zentrale Rolle spielt. Von „Kopfmusik“ beginnend über „Satz für ein Klangauge“ hin zu „Brendels Fantasie“ und zur „Entführung der Anna Netrebko“ – Musik und Scheitern allüberall. Es ist eine besondere Form des Scheiterns, der die Charaktere erliegen: Sie scheitern nicht an technischen Rahmenbedingungen, nicht an ökonomischer Unterausgestattetheit und damit verbundener Nicht-Realisierbarkeit von Projekten, sie scheitern an ihren Vorstellungen, an ihren Phantasien, sie scheitern daran, dass die Realität mit der Welt, wie sie ihrer Vorstellung nach zu sein habe, nicht in Übereinklang zu bringen ist. Der Ursprung für diese Diskrepanz ist in den „Melancholischen Billeteuren“ in der Familiengeschichte zu finden: Die autoritären Vaterfiguren, dominant, selbstherrlich, dem Alkohol nicht abgeneigt, bringen Edwin und Dora dazu, sich einer Ersatzwelt zuzuwenden, diesenfalls der szenischen Kunst am Burgtheater. Was als Selbstemanzipation zu einem eigenständigen Leben führen könnte, mündet bei den beiden aber in eine Form der fortwährenden Abhängigkeit. Edwin kümmert sich trotz stetig sich wiederholenden Denunziationen um seine Mutter, der ihr neurotischer Papagei näher steht als der Sohn, Dora führt eine On-Off-Beziehung mit dem hochstaplerischen Versicherungsagenten Viktor. Beide wiederum nehmen sich des Juweliers Schlössheimer an, leidenschaftlicher Theaterbesucher und vom Vater verhinderter Bewerber am Reinhardt-Seminar. Es sind die Bühnenbretter, die den beiden Hauptfiguren die Welt bedeuten. Manches Mal, so möchte man ihnen zurufen, befindet sich eines dieser Bretter aber direkt vor dem eigenen Kopf und verstellt einem so den Blick auf die Welt, wie sie auch sein könnte. Besser wäre es dann, dieses Brett zu nehmen und es als Werkzeug zu nutzen, sich einen neuen Weg zu bahnen, aus der Möglichkeitsform heraus, in die Wirklichkeit hinein.
Das Verhältnis zwischen Wirklichkeit und Fiktion ist ein weiterer wesentlicher im Werk des Autors. Günther Freitag ist bekennender Vertreter eines literarischen Ansatzes, der der Phantasie stets das Primat gegenüber der Realität zu geben bereit ist. Die Realität verschränkt sich mit dem Phantastischen, Realitätsgrenzen verschieben sich ins Groteske, Absurde oder Wahnhafte. Interessant dabei ist, dass sich spätestens seit dem Roman „Flusswinter“ die Realität konkret in das Werk Freitags schleicht. Sei es die wirtschaftlich- politische Lage Italiens in „Die Mosaike von Ravenna“, sei es der ehemalige Bundesminister für Landesverteidigung, Karl Lütgendorf, in den „Melancholischen Billeteuren“ – das Reale heftet sich an das Fiktionale. Erstaunlich ist der dadurch entstehende Effekt: Die eingewobenen historischen Versatzstücke spitzen das Dunkle, Verdrängte aus der Vergangenheit noch weiter zu. Wo die psychisch und physisch gewalttätigen Vaterfiguren des Romans mit historischen Persönlichkeiten kurzgeschlossen werden, entwächst aus dem Düster-Unheimlichen des Fiktionalen der Blick auf die Realität und als Lesender wird man sich bewusst, dass es sich bei dieser um ein noch viel größeres Pandämonium des Monströsen handelt. Über die Jahre hinweg hat Günther Freitags Werk so eine Form angenommen, die es als sehr markantes innerhalb der österreichischen Gegenwartsliteratur ausweisen. Die „Melancholischen Billeteure“ sind das aktuellste Zeugnis dieses Schaffens, in dem sich konsequent eine ganz eigene Sprachmelodie und -welt verdichtet.