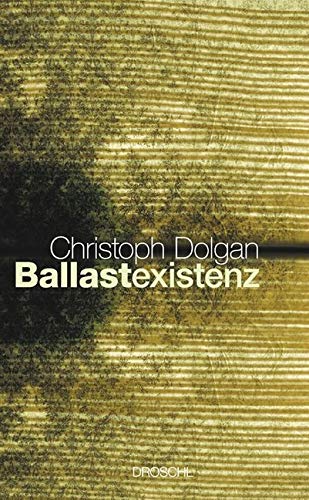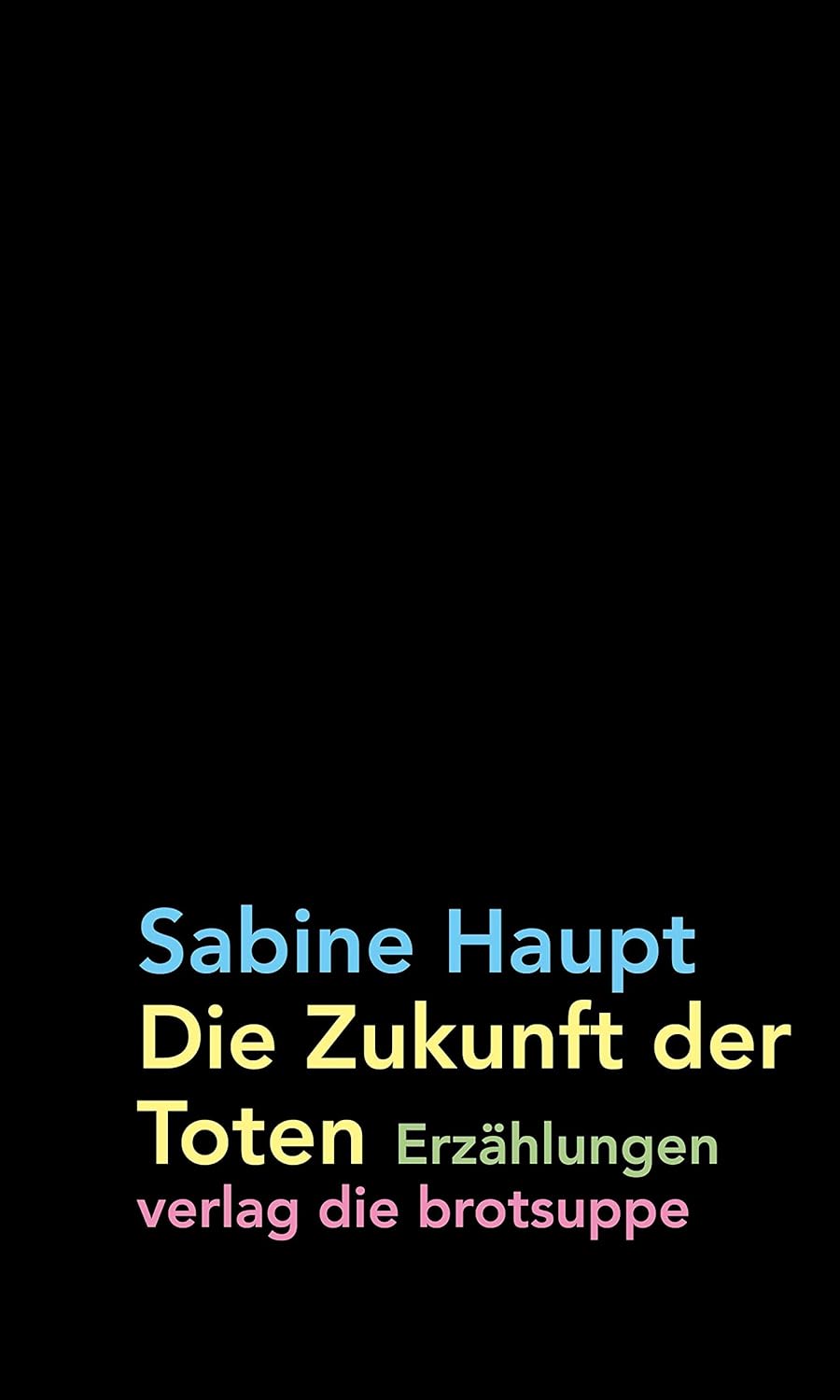In dubio contra
Christoph Dolgan hat ein großartiges Buch geschrieben und möchte das nicht überbewerten
Im Herbst werde sein erstes Buch erscheinen, sagte Christoph Dolgan, als wir uns vor knapp einem Jahr getroffen haben. Nachsatz des Jungmeisters selbstzweifelnden Understatements: Er sei aber nicht völlig zufrieden damit. Von wegen! – Ballastexistenz, im Herbst 2013 im Literaturverlag Droschl erschienen, ist ein grandioses Debüt. Es erzählt aus der Perspektive eines Heranwachsenden vom Elend des Alkoholismus, der nicht nur die Alkoholkranken, sondern auch ihr Umfeld erfasst. In Dolgans Buch ist es eine Säufer-Mutter, die sich und ihren Sohn in den Abgrund zieht.
„Der Weg zur Toilette wird immer länger. Nachts ist er ihr kaum noch möglich. Sie schläft am Küchentisch ein, und ihr Kopf fällt vornüber auf die rot-weiß-karierte Plastiktischdecke, die unzählige Zigarettenbrandlöcher hat. […] So kotzt sie gleich im Schlafen, und das Erbrochene liegt feinsäuberlich vor ihrem Mund auf der Tischdecke.“
In Österreich gelten 350.000 Meschen als alkoholkrank im pathologischen Sinn. Dolgan beschreibt aus dem Gefühl der Beklemmung heraus, das sich in das Kind der Säuferin frisst, eine mögliche Biografie eines dieser Menschen. Die Mutter des Protagonisten ist Kassiererin in einem Supermarkt in der „Langfeldsiedlung“ irgendwo in Österreich; nach getaner Arbeit trifft sie sich mit Freundinnen im Tankstellentschecherl und säuft Wodka bis zur Besinnungslosigkeit.
„Die Leute in der Langfeldsiedlung kennen Mutter: Sie ist ein Begriff, selbst noch unter denen, die ein Begriff sind. […] Die Leute rufen mich an, wenn sie sie irgendwo herumliegen sehen. Oft ist es auch nur eine SMS, die ich bekomme. Eine Ortsangabe, ohne Kommentar.“ Die Schilderungen des körperlichen und psychischen Verfalls der Mutter ziehen sich als roter Faden durch die erste Hälfte des Buches und konfrontieren den Leser in distanzierten Schilderungen direkt mit der Orientierungslosigkeit und emotionalen Überforderung des Kindes. Er sei ihre Ballastexistenz, wirft die Mutter dem Jungen einmal vor. Der wiederum lagert seinen längst versiegten Schmerz aus, indem er sich verletzt – beispielsweise das Glas von Glühbirnen zerkaut –, bevor er später, im zweiten Teil des Buches, in die Mühlen der Kinder- und Jugendpsychiatrie gerät.
Christoph Dolgan, Jahrgang 1979, hat an der Universität Graz Germanistik studiert und über die „Poesie des Begehrens“ bei Leopold von Sacher-Masoch dissertiert. Vielleicht ist er deshalb mit psychischen Abgründen so vertraut. Und vielleicht ist daher auch der Stil seines Debüts so makellos. Das Raffinierte daran: Das Buch gibt die Beklemmungen, die die Kinderseele erfüllen, durch Distanz wieder. In den Text mischen sich Beobachtungen, Assoziationen und Bilder, die am Ende die emotionale Ausweglosigkeit des Jungen auf den Punkt bringen und – ohne dass sich der Autor in Betroffenheitsprosa suhlen würde – betroffen machen.
Wieder wiegelt der Autor ab, diesmal in einer E-Mail: „ich würde jetzt natürlich gerne sagen, dass das eine ausgeklügelte, narrative strategie war (naja, ein bisserl gewollt war es schon), aber im großen und ganzen befürchte ich, ist das einfach eine folgeerscheinung meiner weltwahrnehmung, die meistens auf (dingliche) details ausgerichtet ist – und die figuren sind dann induktive djangos, die ausgehend davon welterklärungs-hüftschüsse abgeben …“ – Oder, wie es im Auftakt zur Ballastexistenz heißt: „Erst der Rahmen, sagst du, mache aus dem Menschen einen Gefangenen. (Du möchtest beiläufig klingen und selbstverständlich, aber alles, was du sagst, ist Ausnahmezustand.)“