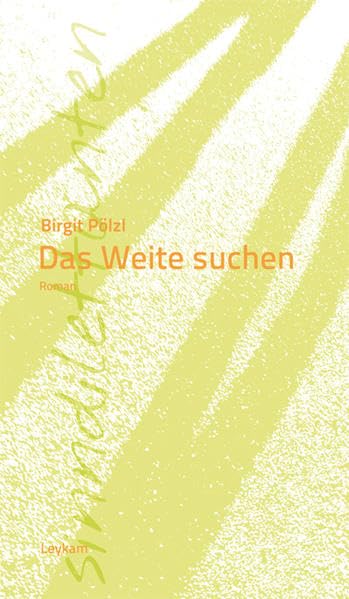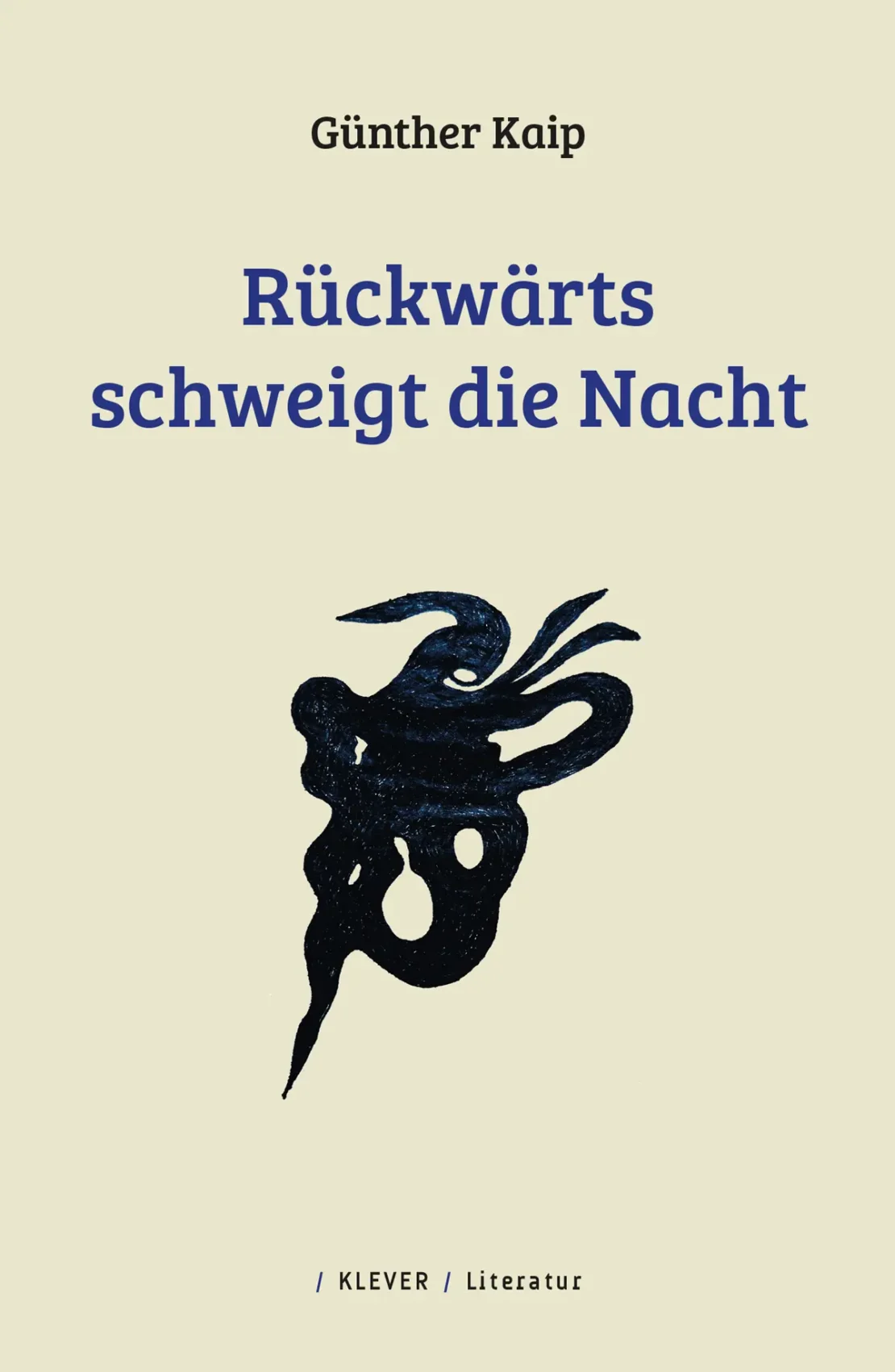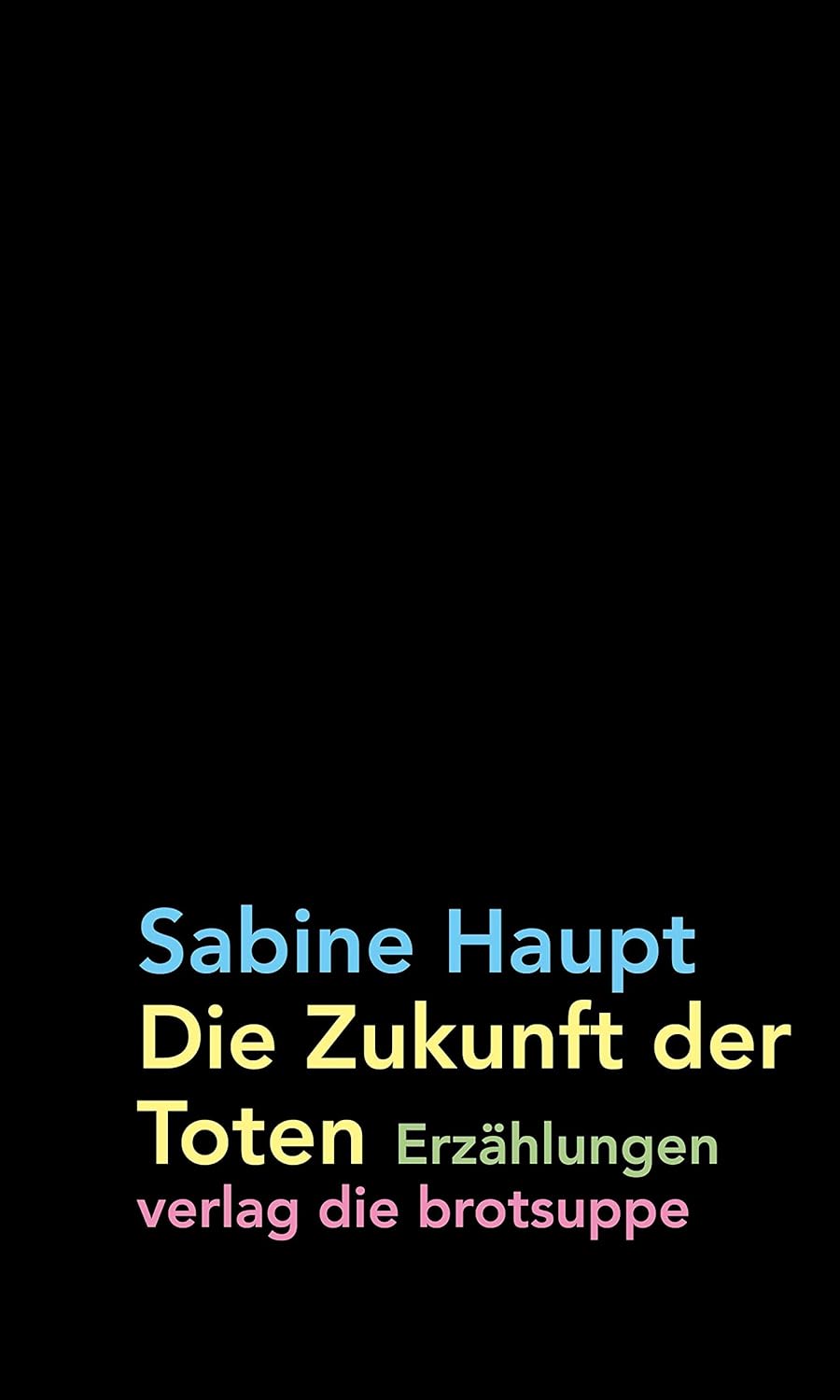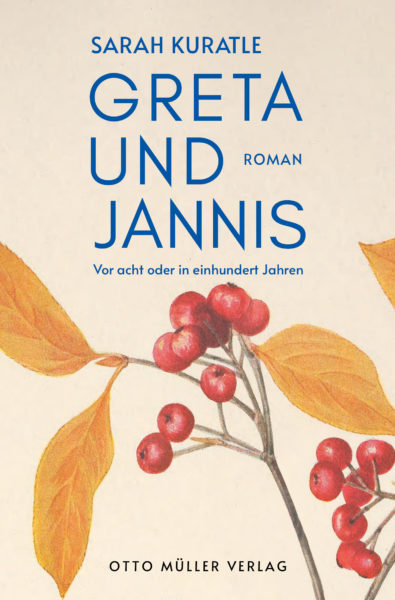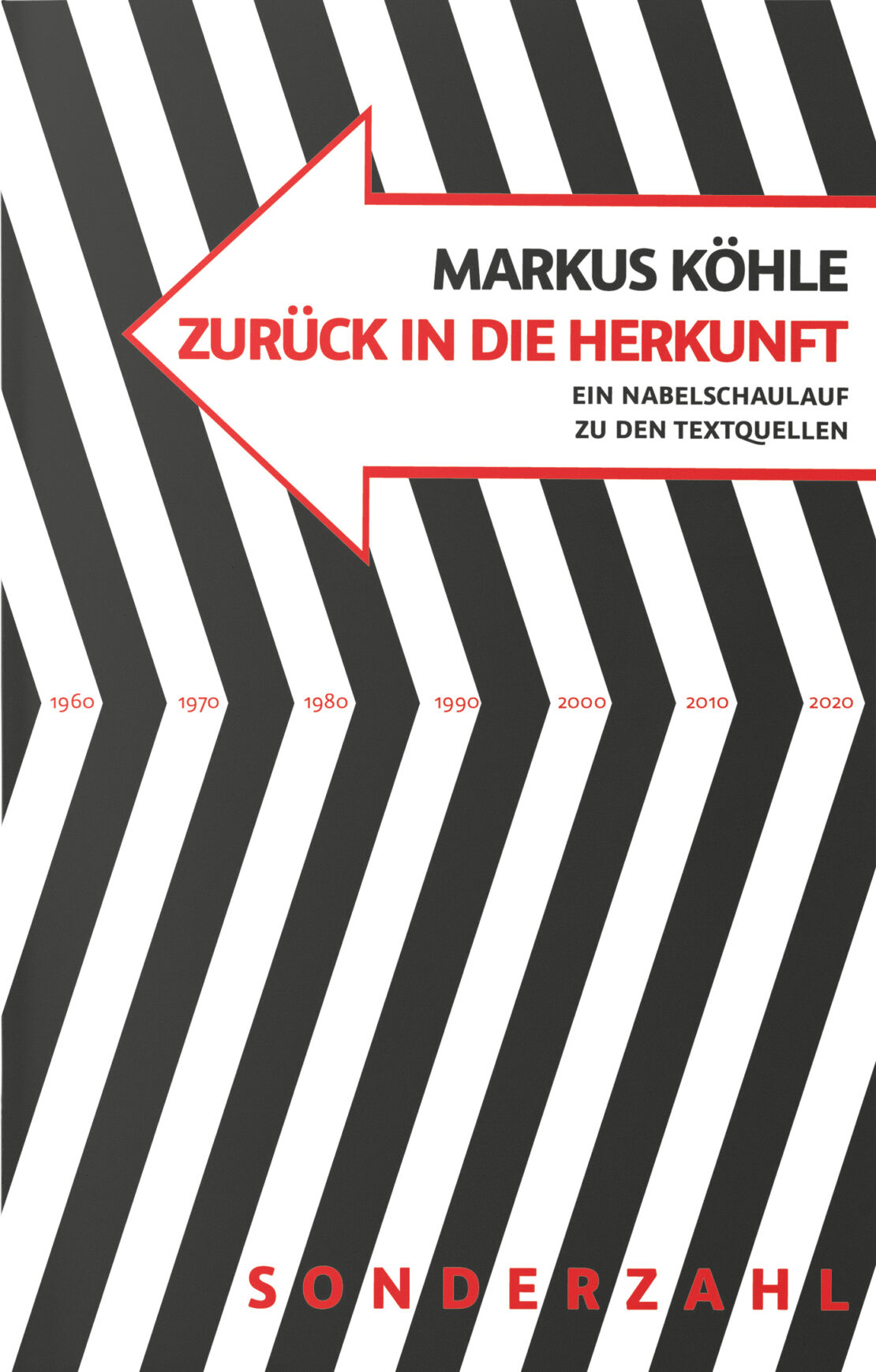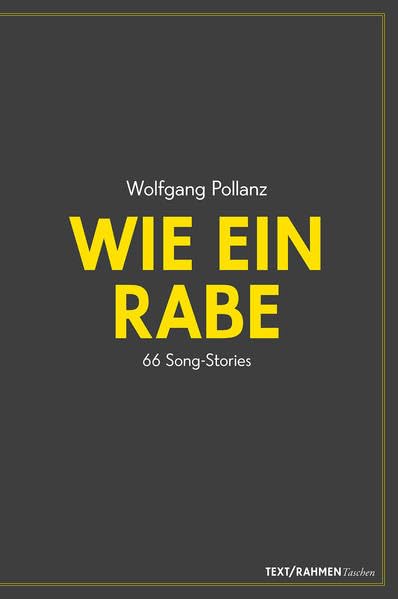Blühende Erdbeeren
Wenn Menschen das Weite suchen
„Die Erdbeeren blühen“ – dieser Satz kehrt wieder in Birgit Pölzls jüngstem Roman Das Weite suchen und hat eine ähnliche Wirkung wie Kerzen und Gaslampen anstatt Strom und Feuer im Kamin: Die Menschen werden wehmütig, wenn sie daran erinnert werden, was ihnen manchmal fehlt. Und so kann man wieder einen Roman lesen, in dem es wieder einmal wieder ein paar junge Menschen mit dem „einfachen, reduzierten“ Landleben aufnehmen wollen – Verzicht ist nicht das Ziel, nur langsamer zu werden, langsamer und konzentrierter.
Es sind mehrere Erwachsene, Frauen und Männer, ein Haufen Kinder, eine Alleinerzieherin mit Adoptivtochter und ein Schamane, die für ein Jahr ihr Leben auf Duschen im Freien, Kühe und Ziegen, mehr Draußen- statt Drinnen-Sein und reichlich Gemüsegerichte umstellen wollen. Die Grazer Autorin Birgit Pölzl zeichnet die Figuren zwar ideologisch motiviert, vor allem aber genervt, angeödet und erschöpft von Wachstumsraten, Pferdestärken, Markenkleidung, Cluburlauben, Wohnungsgrößen, korrigierten Körperteilen und dem Neoliberalismus und was man im weitesten Sinne darunter verstehen mag. Abgesehen davon tragen die Männer und Frauen unter der Schicht von politischem Ekel ihre persönlichen Themen und Lebensabschnittsentscheidungen, Einsamkeiten, Krankheiten oder Wünsche mit auf einen kleinen Hof im katholischen Österreich, um ihr „gelingendes Leben“ zu probieren.
Es handelt sich nicht um 1968 und auch nicht um die alternativen 1980er, aber Birgit Pölzl lässt ihre Figuren nicht um die altbekannten Konflikte herumkommen: Die Kirchengemeinde des katholischen Pfarrers zeigt sich erstaunlich traditionell und daher glaubend feindselig, die Einwohner der Ortschaft haben sich offensichtlich noch nicht an Zuzug generell gewöhnt und sehen die „Zuag’roasten“ (Zugereisten) an sich als Problem. So wird der Umgang mit dem Fremden an sich vordergründig zum Hauptthema.
Nazi-Relikte wuseln nur in Form eines Hundes mit seltsamem Namen und ästhetischer Unsicherheiten der Protagonisten beim Sensenmähen durch die geschriebene Sprache Birgit Pölzls, welche Mundart ostentativ in Klammer setzt und das Dilemma mit dem windischen Bayrisch stilistisch nicht voll auskostet. Manche Neologismen stehen da und dort einsam herum, die Perspektiven wechseln, die Erzählstimme redet manchmal erstaunt mit sich selbst, wenn sie einen absichtlichen Konjunktiv der Dorfbewohner bemerkt oder eine Wortübernahme durch die Dörfler von den neu Zugereisten. Birgit Pölzl geht es (auch, aber) weniger um Prozessbeschreibungen als um Zustandsbeschreibungen: Die zugereisten Personen bleiben ruhig im Hintergrund, sprechen poetisch, schreiben Briefe und Prosa, kontemplativ ernst geht es manchmal zu, religiöse Erlebnisse inbegriffen. Tränen gelacht werden in der Erzählung nur ein Mal: wenn das halbe Dorf einen Dildo findet. Aber das Essen schmeckt besser, wenn man viel an der frischen Luft war und die Kinder wollen sowieso immer lieber nur am Land leben, und zwar für immer – und die Tiere sowieso.
Die Erzählstimme bringt Vergleiche mit Heimatfilmen, die nicht notwendigerweise jedem einfallen würden, und das erzählte Jahr ist rasch gelesen, da hat man sich gerade mit den Personae angefreundet und hätte nichts dagegen, wenn das Buch dreimal so viele Seiten hätte.